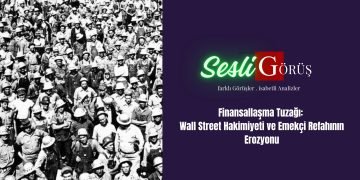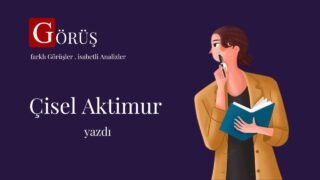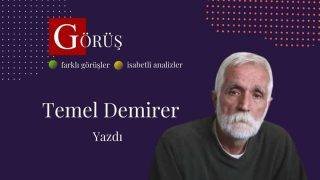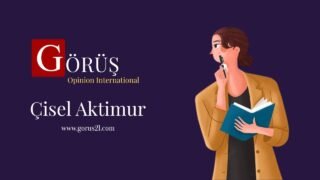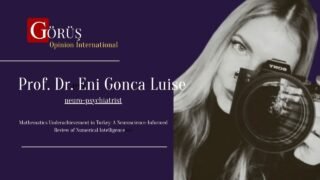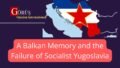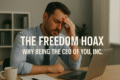Tatsachen oder „Wahrheiten“ entstehen nach Ludwik Fleck durch eine besondere Beziehung des Wahrgenommenen zum Denkkollektiv. Hierbei spielt ein Denkzwang eine sehr zentrale Rolle.
Da man sich einem Kollektiv angeschlossen hat, bzw. zu dieser soziologischen Gruppe gehört, ist die Wahrnehmung eingeschränkt. Dieses Beispiel ist analog auf andere Lebensbereiche anwendbar. Eine Religionsgemeinschaft, Partei, Berufsgruppe, Dorfgemeinschaft, Region oder eine sehr spezielle kleine Gruppe stellen ein Denkkollektiv dar.
Gute Beispiele sind unsere alltäglichen Erfahrungen. Wenn wir zum Beispiel von der „Schwerkraft“ sprechen, aber sagen, dass etwas fällt oder dass die Sonne „aufgeht“, stellen wir nicht zwingend die Wahrheit dar. Dennoch fühlen wir uns gezwungen die Sprache so zu gebrauchen, wie es auch andere tun. Oder wir glauben an jeden Unsinn, woran auch die Gemeinschaft glaubt, in der wir aufgewachsen sind oder uns momentan aufhalten.
Erkennen nach Fleck ist eine dreigliedrige und eben keine zweigliedrige Beziehung, die zwischen dem Erkennenden, dem bereits Erkannten und dem zu Erkennenden besteht. Das dritte Glied ist demnach kollektiv zu verstehen. Ludwik Fleck und Thomas Kuhn erkennen die sozialen Faktoren und berücksichtigen die Geschichte der Wissenschaft. Für sie gibt es keine radikale logische Trennung zwischen Entdeckungs- und Begründungszusammenhang einer Theorie (Genesis vs. Geltung).
Ludwik Fleck stellte den Tatsachenbegriff in Frage. Seine Grundannahme ist, dass die individualistische Erkenntnistheorie nur zu einer fiktiven und inadäquaten Konzeption von wissenschaftlicher Erkenntnis führt. Wissenschaft ist nach Fleck eine Tätigkeit und kein Konstrukt.
Die Wissenschaftler stellen also eine soziologische Struktur dar. Sie bilden ein Denkkollektiv, eine soziale Einheit, eine Gemeinschaft die denkstilgebunden Wissenschaft betreiben. Ein Denkstil ergibt sich vielmehr aus Gewohnheiten und Traditionen des Denkkollektivs, welcher innerhalb einer Ausbildung an Nachwuchswissenschaftler vermittelt wird.
Angehende Wissenschaftler werden in den Denkstil sehr streng sozialisiert und entsprechend ausgebildet, sodass sie wahrgenommene Phänomene so verarbeiten, dass sie in das System (den Denkstil) passen. Mit anderen Worten bezeichnet Fleck den Denkstil auch als „gerichtetes Wahrnehmen“. Dazu gehören auch Praktiken und Vorgehensweisen der Wissenschaft.
Durch den Denkstil ist jede Beobachtung vorprogrammiert, sodass eine „reine Beobachtung“ nicht mehr möglich ist. Dies ist nicht zwingend negativ zu verstehen, da der in der Praxis trainierte Wissenschaftler trainiert ist, wissenschaftlich „relevante“ Dinge zu sehen. Für Fleck gibt es kein voraussetzungsloses Beobachten, sondern das anfängliche unklare Schauen und das entwickelte unmittelbare Gestaltsehen. Auch in anderen Denkkollektiven oder sog. Bubbles verhält sich das nicht anders. Oft ist es beinahe vorbestimmt, wie wir Ereignisse wahrnehmen und welche Aspekte für uns entscheidend sind.
Als Laie stehen wir außerhalb des Kreises der Wissenschaft, daher ist unsere Beziehung zu Wissenschaftler/Politiker/Gelehrte durch das Vertrauen geprägt. Wer sich entschieden hat sich mit der Virologie zu beschäftigen, um die Aussagen C. Drostens zu widerlegen, muss sich zwingend an den Wissensbestand richten.
Unsere Tatsachen würden aus diesem Wissensbestand entstehen. Zum engeren Kreis könnte man als Virologe/Wissenschaftler gehören, um konkrete Forschungen über ein spezielles Virus zu betreiben.
Bis dahin müsste man als Wissenschaftler sehr stark in diese Richtung trainiert werden und von Spezialisten ausgebildet werden, an deren Wissensbestand man selbst als angehender Wissenschaftler vertrauen müsste. Man steht in ständiger Wechselwirkung mit dem Denkkollektiv.
Die speziellen soziologischen Strukturen und empirische und spekulative Überzeugungen werden bei Fleck mitberücksichtigt. Wissen ist nach Fleck nur unter der Bedingung inhaltlich bestimmt.
Wissen und Wahrheit sind nur mit inhaltlich bestimmten Prämissen über wissenschaftliche Gegenstände möglich. Wissenschaftliche Beobachtungen sind grundsätzlich denkstilgebunden und bei speziellen Forschungsgebieten nimmt die Denkstilgebundenheit zu. Dadurch geht die Möglichkeit, Fehler und Widerspruch erkennen zu können, verloren.
Tatsachen entstehen somit durch einen Denkzwang, sodass das Ergebnis auch dem wissenschaftlichen Denkstil entspricht. Selbst die zu stellenden Fragen werden vom Denkstil bestimmt.
Also, je kleiner der Kreis des Denkkollektivs wird, desto denkstilgebundener werden die Beobachtende/Erkennende oder Experimentierende. Ohne die Vorannahmen über den Gegenstand der Viren hätte sich ein Wissenschaftler kein weiteres Wissen aneignen können. Man kann als Laie nur anfänglich und unklar Schauen, oder es entwickelt sich zu einem dilettantischen oder wissenschaftlichen unmittelbaren Gestaltsehen.
Erkenntnisse entstehen nicht aus dem Nichts. Sie sind bedingt durch den Wissensbestand/Erkenntnisbestand des Beobachtenden bzw. Erkennenden. Ein sozialer Moment, in dem die Erkenntnis entsteht, wäre nicht zu leugnen. Es gibt also keine ‚tabula rasa‘, wie auch Otto Neurath es ausgedrückt hat.
Wir streiten um die Wahrheit, wollen „Fake-News“ und „Lügen“ nicht akzeptieren, haben sehr „elaborierte“ Meinungen über Virologie, auch wenn wir keine Virologen oder nicht mal Ärzte sind. Wir würden gerne der „Lügenpresse“ widersprechen und tun dies mit Verschwörungstheorien, über die noch bei einem Bierchen hitzig diskutiert wird. Wir würden gerne Mut haben unseren Verstand zu bedienen oder unsere selbstverschuldete Unmündigkeit verlassen.
Sehr gerne würden wir zumindest skeptisch sein, doch fühlen wir uns selbst hierbei sehr hilflos und suchen Unterstützung. Letztendlich vertrauen wir nur noch Personen, die wir nicht kennen, an Thesen und Theorien, die wir nicht verstehen. Wir würden gerne recht haben und behalten, am Ende aber glauben wir nur recht zu haben.

studierte Rechtswissenschaften in Bochum und Münster bis zum 1. Staatsexamen und studierte Staats- und Sozialwissenschaften auf Bachelor und Master an der Bundeswehr Universität München. Er ist Offizier bei der Bundeswehr. Halil Topcuk ist schwerpunktmäßig an Religionssoziologie und religionswissenschaftliche Themen interessiert und führt außerdem den Twitter-Account @goethe_jw